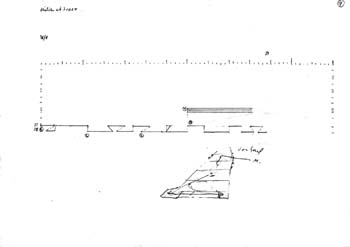
stimmendiagramm (ueberlagerungen)
zu szene IV/1 'mulier et draco'
- off XII
JOHANNES AUF PATMOS
I
Im 'angelus novus' Paul Klees erkannte Walter Benjamin den Engel
der Geschichte, in dessen Flügeln sich ein Sturm vom Paradies
her verfangen hat, der ihn von diesem wegtreibt. Unverwandt rückwärtsblickend
hat er die Heimat vor Augen, aus der er verstoßen ist,
und das Trümmerfeld der inzwischen durchmessenen Zeit. Er
ist nicht allein, ihm müssen andere korrespondieren. Solche,
denen die vorbeifliegenden Ansicht zu beiden Seiten auf entgegengesetzte
Weise gegenwärtig ist, und schließlich auch ein 'angelus
antiquus', der im Ausgang steht und, über die Ruinen der
Geschichte hin, ihr Ende, den anderen Eingang vor Augen hat.
II
In den Zeichen und Stimmen, die 'Johannes auf Patmos' sieht und
hört, sind auch jene beiden zu erkennen: als intelligible
Figur einer endlichen Geschichte, die weder wißbar noch
planbar ist. Ihr Erscheinen wiederspricht geradezu dem inferioren
Wissen, dem Mythos einer begriffenen Realgeschichte, ebenso wie
der Hoffnungslosigkeit, die das Zukünftige ins Niemandsland
der Utopie projiziert.
III
Jener immanente Widerspruch entzog dieses letzte prophetische
Buch dem Mißbrauch durch dogmatische und skeptische Vernunftsformen.
Sein eigener Geist entrückte es in die Wüste des Unzugänglichen,
des anscheinend Obskuren. Im selben Augenblick erkannte Hölderlin
Patmos als 'Insel des Lichts'. Sein Gesang trat auf die Seite
des Geistes, den die Welt vernachlässigt, nun vollends tabuisiert
hatte.
IV
Die Oper folgt diesem Beispiel. Indem sie das allseits gemiedene
Wort in die Realität zurückholt, sie ist Teil jener
'höheren Aufklärung', die derselbe Dichter im Angesicht
der verfinsterten Aufklärung postulierte. Daß hierzu
jene Mittel nicht brauchbar sind, derer sich abgelebte Herrschaftsformen
zu ihrer Erhaltung bedienen, sondern gerade solche, die bislang
in kulturellen Nischen geduldet und mißbraucht wurden,
Mittel also, die bislang als untauglich galten, gehört zur
Dialektik der Aufklärung.
V
Der unerhörte Text selbst bestimmt und verändert die
Mittel der Oper. Er steht nicht zur Disposition, wie andere zur
Wahl stehende Stoffe, sondern disponiert die Form seiner Darstellung.
Als 'vester Buchstab' ist er, seinem eigenen Gesetz nach, unveränderlich.
Er verwandelt sich in Musik, so wie er da ist. In gleicher Weise
beschränkt sich die szenische Darstellung, die das Unerhörte,
das Niegesehene der Visionen und Auditionen nicht theatralisch
kolportieren darf. Ihre Gegenstand ist nicht das Gesicht des
Sehers, sondern er selbst. Dies wenig Scheinende ist schon genug.
Stellvertretend für alle erfährt 'Johannes' die Leiden
und Entzückungen des Ganzen. Seine Stimme ist das subjektiv-expressive
Echo des objektiven Sturms.
VI
'Patmos' bezeichnet die Situation des Exils schlechthin. Den
Ort des Ausgesetzseins. Das Extrem der äußersten Vereinzelung.
Ein Einzelner in seiner Isolation erscheint als Zeuge, als Membran
des Ganzen. Weil er, als bloßes Objekt des Offenbarenden
regungslos bliebe (so Hölderlin 1798 an Isaak von Sinclair),
notwendigerweise in zweifacher Gestalt. Einmal als das vom Überweltlichen
überwältigte Subjekt, nach seinem eigenen Wort 'im
Geist', zum anderen als bewußtes Subjekt, das festhält,
was ihm geschieht.
VII
Die Stimmen des Ganzen, repräsentiert von den übrigen
Sängern und Instrumentalisten, umgeben jene Insel als spirituelle
Realität, betreten sie zum Zeichen, daß diese nicht
weniger wirklich sei. Sie sind auf diese Weise Teil der Handlung,
die eben im vielstimmigen, erschütternden Dialog des Ganzen
mit dem Einzelnen besteht. Das Buch, das nichts als jene Zwiesprache
enthält, war deswgen auch immer schon Libretto und mußte
nur als solches erkannt werden.